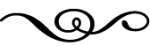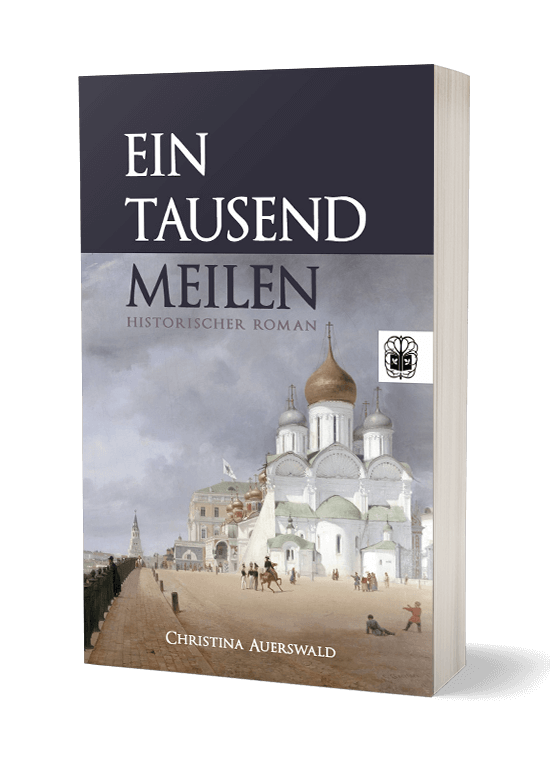
Eintausend Meilen
Christina AuerswaldAls das blitzende Metall der Klinge auf den Hals traf, gab es ein knackendes Geräusch. Stefano kniff die Lippen zusammen, obwohl er sich fest vorgenommen hatte, keine Miene zu verziehen. Ein Stöhnen ging durch die Reihe der Jesuiten neben ihm; keinem war es gelungen, reglos zu bleiben. Der Kopf von Pater Crescentio Falcone polterte zu Boden.
Der Henker trat zur Seite, um dem Gerichtsdiener Platz zu machen, der ein Pergament entrollte und verlas. Ohne einen einzigen Blick auf den Leichnam zu seinen Füßen verkündete der Diener in weit über den Platz zu hörendem Mandarin-Chinesisch, dass mit dem Tod des Verbrechers der Gerechtigkeit und dem Willen des Allerhöchsten Kaisers Kangxi Genüge getan und die Ahnen der Vorfahren besänftigt waren. Der Allerhöchste habe Gnade bewiesen. Als Todesart sei zuerst das Lingchi bestimmt gewesen, der Tod der tausend Schnitte, um zu sterben wie man langsam bergauf geht. Der Kaiserliche Hofastronom Guànjūn Thomas habe jedoch um Gnade gebeten, weil es in dem Land, aus dem sie kämen, nicht üblich sei, langsam Stückchen des Körpers mit dem Messer abzuschneiden, um den Tod zu schenken. Der Allerhöchste habe seine Ahnen befragt und von ihnen die Erlaubnis erhalten, dem Gnadengesuch des kaiserlichen Astronomen nachzukommen und den auf die verdiente Weise vorgesehenen Tod des Verbrechers in eine Enthauptung umzuwandeln. Damit habe man den Ritualen Tribut gezollt, die jedem Menschen von seiner Wiege her bestimmt seien und niemand das Recht habe, sie ihnen zu verwehren.
Die Jesuiten links und rechts von Stefano senkten bei diesem Satz den Kopf tiefer. Sie hatten die Anspielung verstanden. Mit dieser Gnade beschämte der Kaiser sie alle, weil sie unverdient war. Der Gerichtsdiener rollte das Pergament ein und stieg von dem Podest, auf dem der Henker seiner Arbeit nachzugehen begann und den Leichnam zur Seite zerrte.
Die Menschenmenge löste sich auf, die sechs Jesuiten blieben stehen. Es war ihnen befohlen worden, der Hinrichtung zuzusehen, also mussten sie auch warten, bis ihnen erlaubt wurde zu gehen. Nicht weit von ihnen entfernt lag der Tempel der Sieben Winde mit dem heiligen Schrein irgendeiner Gottheit, Stefano hatte vergessen, welcher. Einer der kaiserlichen Beamten musste diesen Platz für sie zum Warten bestimmt haben, weil jeder wusste, dass die Anbetung der vielen einheimischen Götter für die Jesuiten schwer zu ertragen war; es sollte also nichts weiter als eine Provokation sein, sie ausgerechnet hier warten zu lassen.
Dass sie abseits der anderen Leute standen, wäre nicht nötig gewesen. Sie fielen sowieso auf, in erster Linie wegen ihrer teils blonden und braunen Haare und ihrer Körpergröße. In ihrer Heimat war keiner von ihnen besonders groß gewesen, aber hier ragten sie aus der Masse der Chinesen heraus. Sie trugen Kleider, die denen der Einheimischen ähnelten, lange Gewänder, ihrem Wunsch entsprechend dunkel und ohne Stickereien. Niemand von den Umstehenden verstand diesen Wunsch nach Schmucklosigkeit. Wer hier etwas auf sich hielt, zeigte mit der Farbe und kunstvollen Bearbeitung seines Rocks sein gutes Einkommen und die Nähe zum Kaiser.
Nachdem die sterblichen Reste von Pater Crescentio in einem Korb weggebracht worden waren – Stefano vermied den Gedanken, was man möglicherweise damit tun würde – drängten die Palastwachen die sechs Jesuiten von ihrem Platz fort in Richtung zur Schranke vor der Hinrichtungsstätte. Sie folgten Pater Joachim bis zum Eingang des kleinen Hauses, in dem sie wohnten und ihre Andachten abhielten. Es war eine der Hütten am Rand des Platzes, mit Stroh gedeckt statt mit gebrannten Ziegeln, die man hier in hoher Kunstfertigkeit zu geschwungenen Dachgiebeln auftürmte. Es war eine der Wohnstätten armer Palastbediensteter, von denen es eine unübersehbare Zahl gab, sobald man sich aus der Mitte der Pracht entfernte. Ganze Familien mit drei oder vier Generationen lebten in einer einzigen Kammer, mit rußgeschwärzten Wänden vom Rauch der Herdfeuer, gestampftem Lehm als Fußboden und einem Loch für die Notdurft hinterm Haus. Das Loch störte Stefano nicht, wohl aber das Stroh auf dem Dach. Es regnete an vielen Stellen durch, kaum konnte man die wertvolleren Besitztümer wie die Bibel oder die Messgewänder vor Feuchtigkeit schützen. Es bedeutete auch, dass sie nach jeder Regenzeit das Dach neu decken mussten, weil kein Stroh den Regen dieses Landes länger als eine Jahreszeit lang ertrug.
August 1716. Eintausend Meilen zu Fuß durch wildes, fremdes Land? Katharina geht, ihr Kind in den Armen, durch eisigen Wind und Kälte. Stefano im fernen China ist ihr Ziel. Schon in Moskau türmen sich schier unüberwindliche Hinernisse. Denkt Stefano als Missionar im fernen Peking noch an sie? Wird er sie überhaupt sehen wollen?
Dieses Buch ist der zweite Band der Reihe „So weit der Himmel ist“ und folgt auf „Die Mission des Stefano Cavallari“.