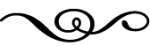Stadtbrand
Reiner Wohllebe„Zur Urteilsverkündung erheben Sie sich bitte.“ Pause, Murmeln, Stühlescharren. „Die Klage wird abgewiesen. Die außergerichtlichen Kosten werden dem Kläger auferlegt.“
Ich hatte also gewonnen. Die außergerichtlichen Kosten waren nicht hoch, denn ich würde selbst nichts geltend machen. Was auch? Anwaltskosten, um mich selbst zu verteidigen?
Der Kläger war nicht persönlich anwesend, das erleichterte die Sache. Winkler kam nie persönlich, das hatte er auch früher schon nicht getan, als ich sein Anwalt war und er mein Mandant. Noch dazu war er dreiundneunzig, sein knapp siebzigjähriger Sohn führte die Geschäfte für ihn, Winkler junior. Auch ihn hatte ich noch nie zu Gesicht bekommen. Das Murmeln von den Zuschauerplätzen schwoll an, man schaute zu mir herüber, lächelnd, nickend. Das Wohlwollen lag auf meiner Seite, aber nicht zu übersehen waren auch Zeichen von Misstrauen, gerunzelte Brauen, das Wegschauen, wenn ich mich umsah. Wenn ich gewollt hätte, wäre es anders gelaufen. Die Verhandlung war öffentlich gewesen, ich hatte nichts anderes beantragt, obwohl mich der Richter darauf hingewiesen hatte, dass es für mein Ansehen sinnvoll und auch verfahrenstechnisch möglich gewesen wäre, die Öffentlichkeit auszuschließen. Ich habe nur genickt und keinen Antrag gestellt.
Das Interesse kam in erster Linie aus Fachkreisen. In den Zuschauerreihen saßen eine Menge Leute, die sonst nicht hinten sitzen, sondern einen der Plätze vorn zur Linken oder Rechten des Richters belegen. Die meisten von ihnen kannte ich. Es waren vor allem ehemalige Kollegen, die sich wahrscheinlich die ganze Zeit fragten, ob sie selbst auch in eine solche Situation kommen könnten und was sie tun würden, wenn sie ich wären. Man hatte mich der Verleumdung angeklagt, und zwar aufgrund meiner Tätigkeit als Anwalt.
Sie haben alle keine Ahnung. Ich glaube auch nicht, dass die anderen jemals in eine solche Situation kommen. Es ist unwahrscheinlich, dass sie mich verstehen. Ich hätte mein Verhalten selbst auch nicht verstanden, bevor ich das alles erlebt hatte. Sie wissen, dass ich krank war, das erleichtert ihnen die Distanzierung. Man kann sich kaum vorstellen, wie schnell ein solches Gerücht durch die entsprechenden Kreise läuft: Dr. Eilenburg ist in der Klapsmühle! Auch wenn sie zehnmal wissen, dass das nicht so heißt, sie sagen es, weil es einem die Gänsehaut über die Arme treibt. Die mit der besseren Kinderstube sagen: Dr. Eilenburg ist im Krankenhaus für Psychiatrie, und dann flüstern sie: in der geschlossenen Abteilung.
Mag sein, dass ein Teil des Publikums zur Verhandlung nur kam, weil es wissen wollte, ob ich wieder normal wäre. Normal in dem Sinn, dass ich wusste, was ich als Anwalt zu tun hatte, war ich. Oft erinnerte ich mich an den Witz, wo einer im Auto einen Anruf bekommt: Du, Fritz, auf der Autobahn ist ein Falschfahrer! Und Fritz sagt: Einer? Hunderte!
So kam ich mir vor, wie der einzig Normale unter all denen, die es einfach nicht begreifen. Natürlich bin ich reflektiert genug, um zu merken, dass es andersherum ist. Ein Einzelner kann nicht das Maß der Normalität bestimmen. Was normal ist, bestimmt die Masse, und dazu gehöre ich nicht. Ich habe meinen Prozess zu Ende gebracht, weil es notwendig war. In unserer Gesellschaft kann ein Prozess nicht ohne Ende sein, also habe ich mich bemüht, ihn so schnell wie möglich über die Bühne zu bringen. Ehrlich gesagt, es war mir wichtig, nicht aus dem Grund, den alle anderen für wichtig hielten, sondern weil Winkler ein letztes Mal lernen musste, dass er mich nicht vernichten kann.
Als Anwalt konnte ich mich selbst vertreten. Ich gebe zu, es war eine Erleichterung, dass ich gewann und meinen eigenen Ruf retten konnte, soweit ich noch einen besaß. Der eine oder andere meinte vielleicht, der Richter wäre wegen meiner Diagnose von einer Spur Mitleid beseelt gewesen. Jeder Kenner der Materie weiß, dass das nicht sein kann. Richter sind in solchen Sachen unerbittlicher als sonst, keiner von ihnen mochte sich nachsagen lassen, nicht objektiv geurteilt zu haben.
Mein eigener ehemaliger Mandant hatte mich verklagt. Seiner Klage war der Versuch vorausgegangen, mich bei der Anwaltskammer anzuschwärzen, aber das war nicht weiter bekannt geworden und verlief im Sande. Die Klage war eine andere Hausnummer. Worum jeder andere bei diesem Verfahren gezittert hätte, war mir gleichgültig. Auf meinen Ruf kam es mir nicht mehr an. Ich wusste schon damals, dass ich nach diesem Prozess alles hinschmeiße.
Dass ich aus der Sache mit Winkler heil herauskommen würde, war von Anfang an unwahrscheinlich. Schon die Tatsache, wegen Verleumdung vom eigenen Mandanten verklagt zu werden, blieb an mir hängen. Ich konnte beweisen, dass ich nicht gelogen hatte. Alles, was ich gegen Winkler gesagt hatte, entsprach der Wahrheit. Er hatte behauptet, ich hätte das Wissen gegen ihn verwendet, das er mir als seinem Anwalt im Vertrauen gegeben hatte, aber ich habe das Gegenteil bewiesen. Ich hatte ihm ein paar gute Geschäfte versalzen, allein dadurch, dass man jetzt in seinen Kreisen über ihn Bescheid wusste.
Das ärgerte ihn am meisten, und deshalb konnte er nicht aufhören, gegen mich zu schießen. Aber ich konnte auch nicht aufhören. Ein paar der guten Freunde, die mir noch eine Weile die Treue hielten, rieten mir dringend, die Füße still zu halten. Aber das konnte ich nicht. Ich war es meiner Stadt und Katrin schuldig. Mein früherer Chef aus der Zeit, als ich noch in der großen Kanzlei tätig war, hätte nie zugelassen, dass es so weit kam. Mit Mandanten, auch ehemaligen, einigte man sich außergerichtlich. Da floss Geld in die eine oder andere Richtung, und die Sache war geklärt. Früher fand ich sein Vorgehen vernünftig. Aber nach der Sache mit Katrin war für mich alles anders. Ich hatte dem gegnerischen Anwalt nicht einmal einen Termin gegeben, als er mit mir reden wollte. Ich wollte keine faulen Kompromisse, an dieser Stelle schon gar nicht, denn es war mein letzter Prozess als Anwalt. Ich gab meine Ein-Mann-Kanzlei auf. Ich musste nur noch die Sache mit Winkler zu Ende bringen, und das war in diesem Moment, mit diesem Urteilsspruch getan.
Das Murmeln im Gerichtssaal ebbte ab. Ich packte meine Unterlagen ordentlicher als sonst ein und sah aus dem Saalfenster in den winterlichen Tag. Alle anderen verschwanden aus dem Raum, der Teppich schluckte die Schritte. Der gegnerische Anwalt hatte mir kurz zugenickt, in seinem Blick etliche unausgesprochene Fragen. Ich hätte ihm gern geantwortet: Ich wollte den Prozess, es geht mir gut, ich bin besser drauf als ihr alle. Aber er hatte sich schon umgedreht und war davongegangen. Der Richter und die Ehrenamtlichen waren fort, der Gerichtsdiener rollte auf einem Wagen ein paar Gesetzbücher und Unterlagen weg, die in diesem Fall nicht erforderlich waren. Man war unter sich gewesen, ein beinahe vollständig mit Juristen besetzter Saal.
Ich stand in diesem Gerichtssaal, die schwarze Anwaltsrobe zum letzten Mal über dem Arm, und erinnerte mich deutlich an jenen 16. September 1991, an dem für mich alles begonnen hatte. Es war der Tag, an dem ich Katrin kennengelernt hatte, dieser eine besondere Tag, an dem ich die drei verrücktesten Tage meines Lebens erlebte. Niemand, der einen solchen Satz hört, ist frei von diesem „Das ist nicht möglich!“, das ich dauernd gesagt bekam. Es ist sogar noch schlimmer: Der Auslöser all dieser Erlebnisse war der 16. September 1994. Das geht gegen die Ordnung, da sträubt sich einem das Gefieder, also kann es nicht sein. Kann es nicht? Dabei muss man nur wissen, worum es geht. Es geht bei allem, was wir tun, in Wirklichkeit nicht um die Ordnung der Vergangenheit und der Gegenwart, es geht immer nur um unsere Verantwortung für die Zukunft.
Den gewonnenen Prozess in der Kehle, ging ich langsam den Flur des Gerichtsgebäudes entlang. Falls mich einer beobachtete, sah ich aus wie ein Anwalt, der die Zeit vor dem nächsten Prozess herumbringen musste. Aber weder beobachtete mich einer, noch hatte ich einen nächsten Prozess. Ich hatte stattdessen mein restliches Leben vor mir, und ich wusste nur, was ich nicht damit anfangen wollte, nämlich über diesen Flur zu gehen und auf den nächsten Auftritt in irgendeinem Prozess zu warten. Draußen schien eine blasse Wintersonne, sie drückte gegen die ungeputzten Scheiben und ließ einen Dunstschleier über das unbebaute Grasland gegenüber treiben.
Ich musste daran denken, dass es das letzte Mal war, dass ich diesen Gang entlang schritt, in der einen Hand den schwarzen Lederkoffer mit den Unterlagen – lächerlich wenig, wenn man es an der Bedeutung der Sache maß – und über dem anderen Arm die schwarze Robe. Es war nicht mehr dieselbe Robe wie 1991, die hatte die Ereignisse nicht überstanden. Es war eine neue. Sie war extra auf meine Maße geschneidert, nicht mehr das Stück von der Stange aus meinen Anfangsjahren. Vanessa hatte sie machen lassen. Sie hatte mir gesagt, dass es Glück bringen soll, wenn man unter den schwarzen Samtbesatz ein vierblättriges Kleeblatt einnäht. Damals habe ich ihr gesagt, dass es darauf ankäme, was man unter Glück versteht, und ich frage mich heute noch, woher ich schon 1991 die Weisheit für eine solche Aussage nahm. Ich war zu dieser Zeit noch jung, alles lag vor uns, die Zukunft, die Karriere, vielleicht eine Familie.
Für Vanessa war die Zukunft wie ein langer Teppich, der hier und da eine Stufe bedeckt, die man bloß hinaufsteigen muss. Für mich war die Zukunft seit dem 16. September 1991 eine Sache mit einem Fragezeichen geworden, und drei Jahre später verwandelte sie sich in eine Sache, die nichts mehr mit einem Teppich zu tun hatte. Wenn überhaupt, war es irgendwas mit Steinen.
In diesem Gericht hatte man sich die Zukunft als irgendwas mit Glas vorgestellt. So waren sie, die Architekten der neunziger Jahre: Stahl und Glas, Transparenz als Heiligtum, Kühle und Klarheit als Maximen allen Lebens. Für mich war Architektur, seit ich mein Aufgabengebiet übernommen hatte, eine Art benachbarte Kunst gewesen. Ich war Fachanwalt für Immobilienrecht, und Architekten waren die Künstler, die meine Objekte schufen. Sie konnten sie schaffen, wie sie wollten, Hauptsache, sie schufen sie. Ich hatte dafür zu sorgen, dass sie in die richtigen Hände kamen. Ich achtete ihren Beruf, weil er mir das tägliche Brot verschaffte.
Dieser kühle Neubau aus Stahl und Glas stand am Tag jenes Gerichtstermins schon ein paar Jahre. Früher waren alle Gerichte von Halle über die Stadt verstreut, das Verwaltungsgericht beispielsweise für eine gewisse Zeit am Hansering, das Sozialgericht in der Händelstraße und das Amtsgericht, wo ich meist zu tun hatte, in der Landsberger Straße. Früher heißt: seit der Wende. Vorher zählte nicht. Vorher war nur das Ausgangsmaterial, was mir Arbeit verschaffte. Die Wende war meine Stunde null, was die Arbeit in dieser Stadt betraf, und die Welt teilte sich ein in die Zeit davor und die Zeit danach. Die Wende war der Punkt, an dem aus meiner Sicht die Gerechtigkeit begann. Diesem Zweck hatten die verstreuten Gerichte zu dienen versucht, bis sie poliert, geschliffen, vereinigt wurden. Mit dem neuen Gebäude kam alles unter ein Dach, man fuhr mit dem Aufzug problemlos zwischen Amtsgericht, Familiengericht und Sozialgericht hin und her, und unten standen die Sicherheitsleute.
Ich schaffte es nach meinem Prozess nicht gleich hinaus. Ich rettete mich auf einen der ungepolsterten Stühle in der Cafeteria. Das Scharren der Metallfüße auf dem Steinboden war mir vorher nie aufgefallen, nun überlegte ich, ob ich es in Zukunft vermissen würde. Die Ledertasche kam mir schwerer vor, als ob im Aufzug jemand Gewichte hineingeschmuggelt hatte. Ich holte mir einen dünnen Kaffee und stellte ihn vor mich auf den Tisch, die Legitimation, dass ich hier sitzen durfte. Wenn man so wollte, hatte ich mir den Sitzplatz damit billig erkauft. Auf den Stühlen am Nachbartisch kletterte ein kleiner Junge, vielleicht drei Jahre alt, und seine Mutter, eine stark geschminkte Mittzwanzigerin, sagte, ohne sich zu bewegen, müde dreimal nacheinander: „Kevin, lass das!“, bis sie mit den Augen rollte und den Kopf in den Nacken legte. Auf der anderen Seite saßen zwei mutmaßliche Rentnerinnen zusammen, den Blick fest auf die Anzeigentafel mit den Verfahren gerichtet, als ob sie überlegten, was für eine Vorstellung sie sich am heutigen Tag gönnen wollten. Es mochte sein, dass ein echter Prozess nicht solche dramatischen Wendungen und Enthüllungen lieferte wie im TV-Gericht, aber für die Neugier waren die hiesigen Sachen allemal gut, und wenn es richtig toll kam, kannte man den einen oder anderen Prozessbeteiligten.
In meinen Verfahren hatte es solche Zuschauer auch gegeben, nicht oft, aber ab und zu. Neugierige Fremde waren die Ausnahmen, eher kamen Betroffene. Ich hatte dafür anfangs kein Verständnis. Die meisten meiner Mandanten waren Leute wie Winkler. Sie hatten ein Verfahren in unsere Hände gelegt und vertrauten uns vollständig, und mit dem Geld, das sie uns zahlten, war ihr eigenes Engagement überflüssig geworden. Auf der anderen Seite der Bank sah es anders aus. Es ging um Räumungen, um Besitzverhältnisse, Alteigentum und die Gültigkeit von Kaufverträgen, um Enteignungen in den dreißiger, vierziger und fünfziger Jahren und ein paar windige Verkäufe während der Wendezeit.
Auch auf der gegnerischen Seite saßen Anwälte. Das war ein buntes Volk, ein Konglomerat aus alten Ost-Anwälten und Glücksrittern unter den Jura-Absolventen der achtziger Jahre, die keinen Job in guten Kanzleien oder als Richter bekommen hatten und nun im Osten ihr Auskommen suchten. Solche wie ich saßen auf der gegnerischen Seite nicht. Der typische Ossi konnte uns nicht zahlen, schon gar nicht einer, den wir verklagten.
Diese Anwälte kamen nie allein. Sie taten mir leid, weil sie die halbe Stunde vor Prozessbeginn damit zubringen mussten, ihren Mandanten zu erklären, wie ein Verfahren funktionierte. Oft genug hörte ich sie die Vorstellungen der Leute korrigieren, die ihr Wissen über Gerichts-verfahren aus amerikanischen Fernsehserien bezogen und nach Geschworenen fragten. Diese Anwälte zogen ihre zerknitterten Roben aus den flachen Kunstledertaschen und atmeten tief ein, bevor sie ihre Erklärungen begannen. Die Gestalten an ihrer Seite musterten verblüfft den schmucklosen Gerichtssaal, in dem sie schwere eichene Gerichtsbänke und einen Hammer in der Hand des Richters erwartet hatten. Sie nahmen verwirrt und zögernd neben ihrem Anwalt Platz und hofften, mit den Tränen in ihrem Augenwinkel einen Richter beeindrucken zu können. Ein Richter lässt sich davon nicht aus der Ruhe bringen. Einmal sagte einer von ihnen zu einem empörten Angeklagten: „Wissen Sie, ich stehe hier nicht für die Gerechtigkeit, ich stehe für geltendes Recht.“ Das war, in aller Kürze, das Resümee meiner eigenen Arbeit.
Am 16. September 1991 geschieht dem Rechtsanwalt Dr. Thomas Eilenburg etwas Seltsames. Die Recherchen für einen Klienten führen ihn in den Keller des Grundbuchamtes. Eilenburg ist mit der Rückübertragung einer Immobilie in Halles Innenstadt beauftragt. Der ehemalige Eigentümer ist jetzt im Westen im Ruhestand und möchte sein Haus zurückhaben. Doch Eilenburg, der den Archivkeller gut gelaunt betritt, verlässt ihn als ein anderer: auf einer Krankentrage, auf dem Weg in die psychiatrische Abteilung eines Krankenhauses. Er behauptet, den Stadtbrand von 1683 mit eigenen Augen gesehen zu haben …