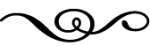Der Schulweg führte uns durch viele Straßen. Überall gab es etwas zu sehen. Am interessantesten war es aber in der Mähnstraße. Schon der Geruch verriet, dass dort viele Bauern wohnten. Zu einem Bauernhof gehörten in den 1950er Jahren neben dem Ackerbau auch Kühe, Schweine und Hühner sowie mindestens ein Ackergaul. In den Ställen standen die Tiere auf Stroh, so dass regelmäßig ausgemistet werden musste. Die Misthaufen in den Höfen wuchsen stetig und erfüllten die Luft mit einem anhaltend würzigen Aroma. War es Zeit, die Felder zu bestellen, wurde der Mist ausgefahren. Dann hatten wir auch schon einmal streng riechende „Mitbringsel“ unter den Schuhsohlen, denn der natürliche Dünger blieb längst nicht immer auf den Karren liegen, mit denen er an seinen Bestimmungsort transportiert wurde. Im Sommer trieben die Landwirte zweimal täglich ihre Kühe durch die Mähnstraße: morgens auf die Weide und abends zum Melken zurück in den Stall. Wir machten uns einen Spaß daraus, Slalom um die Kuhfladen zu laufen, die reichlich über die Straße verteilt waren. Wenn die Ackergäule zur Arbeit auf die Felder geführt wurden, brachten die Pferdeäpfel eine willkommene Abwechslung in unser Hindernisrennen. Im Winter blieben die Kühe im Stall. Auch wenn in der kalten Jahreszeit die Kuhfladen fehlten, gab es dennoch häufig Spuren bäuerlicher Tätigkeit auf der Straße zu sehen. Begleitet wurden sie von einem unnachahmlich säuerlichen Gestank. Der rührte von dem Patsch her, den die Bauern in regelmäßigen Abständen aus den Patschkuhlen auf den Feldern holten, um ihn an das Vieh zu verfüttern. Jedes Mal, wenn ich dieses eklige Gemisch auf dem Patschwagen sah und der widerliche Geruch mir in die Nase stieg, war ich froh, dass ich keine Kuh war und mittags etwas Appetitlicheres auf meinem Teller vorfand. Dass dieser stinkende Futterzusatz eigentlich Zuckerrübenblattsilage heißt, erfuhr ich erst sehr viel später vom Bruder einer Freundin, der zwischenzeitlich den elterlichen Hof übernommen hatte. Der agrarwirtschaftliche Fachbegriff neutralisiert für mich allerdings das Winterfutter und macht es geruchlos. Nur wenn ich von Patsch spreche, entfaltet sich in meiner Erinnerung auch seine unvergleichliche Duftnote.
In der Mähnstraße bildeten die Häuser zwei geschlossene Zeilen. So ist es bis heute geblieben. Die Bauernhöfe waren an den großen hohen Toren zu erkennen, die in der Regel zwei Flügel hatten. Der Hof von Statze Hermann (Hermann Statz) wies jedoch eine Besonderheit auf. Das schwere Tor bestand aus einem einzigen Teil und konnte mit Rollen, die am oberen Rand über eine Eisenschiene liefen, aufgeschoben werden. Wir blieben häufig stehen und beobachteten fasziniert, wie der Bauer die riesige Holzfläche zur Seite bewegte. Dann schauten wir neugierig in den Innenhof. Dort gab es mehrere braune Holztüren, die mit großen Eisenriegeln verschlossen werden konnten. Vermutlich führten sie in die Ställe. Eine dieser Türen fiel besonders auf, denn auf ihrer Außenseite waren zwei dicke rote Buchstaben befestigt. Die Großen, die schon lesen konnten, sagten, es seien ein „A“ und ein „B“. Aber niemand wusste, was die Lettern bedeuteten und was sich hinter dieser Tür verbarg. Dabei hätte ich das zu gern gewusst. Meine Mutter konnte es mir erklären. „AB“ war die Abkürzung für „Abort“ oder – wie die alten Kerpener sagten – für „Abtritt“. Dass das Bezeichnungen für die Toilette waren, hatte ich bis dahin nicht gewusst, denn zu Hause waren diese Ausdrücke nie benutzt worden. Hinter der Tür mit der Aufschrift „AB“ befand sich also das Plumpsklo. Wir besaßen zu Hause ein Klo mit Wasserspülung. Aber bei meinen Großeltern hatte ich Anfang der 1950er Jahre noch ein Plumpsklo kennen gelernt. Es befand sich ebenfalls außerhalb des Hauses. In der Tür war ein Herz, das auch als Guckloch dienen konnte. Deshalb nannte man das Toilettenhäuschen häufig auch „Villa Herz“. Das Plumpsklo meiner Großeltern war mir nie geheuer, weshalb ich es nur im äußersten Notfall benutzte. Eigentlich sah es wie eine harmlose hölzerne Sitzbank aus. Aber jedes Mal, wenn ich den kreisrunden Deckel abgenommen hatte und die Öffnung sah, aus der im Sommer regelmäßig eine Schar Fliegen ins Freie flog, hatte ich Angst, durch dieses Loch zu fallen. Es war so bemessen, dass ein Erwachsener genug Platz hatte. Für meinen Kinderpopo war es viel zu groß und einen Aufsatz, der mir die Benutzung des Klos erleichtert hätte, gab es nicht. Auch die Höhe des Plumpsklos war an der Körpergröße der Erwachsenen ausgerichtet. Ich konnte mich nicht einfach hinsetzen, sondern musste mich mit dem Rücken zum Klo stellen und dann über die Öffnung hüpfen. Zu viel Schwung durfte ich aber nicht nehmen, denn bis zum hinteren Rand des Loches wollte ich auf keinen Fall durchrutschen. Ich hielt mich immer im vorderen Bereich auf, klammerte mich mit beiden Händen am Rand des Plumpsklos fest und hatte nur ein Bestreben: so schnell wie möglich fertig zu werden. Dann hopste ich sofort runter und noch bevor ich die Hose wieder hochzog, legte ich blitzschnell den Deckel wieder auf die Öffnung. Jedes Mal verließ ich den unheimlichen Ort sehr erleichtert darüber, dass ich einem Absturz entgangen war.
Wasser gab es auf einem Plumpsklo nicht, wohl aber Toilettenpapier. Es wurde aus alten Zeitungen hergestellt. Meine Oma schnitt die Zeitungsblätter auf ein gleich großes quadratisches Format, zog in der oberen Ecke eine Kordel durch und hängte den Vorrat dann an einem Nagel in der Wand neben dem Plumpsklo auf. Bei längeren Sitzungen bot sich den Erwachsenen so die Möglichkeit, die versäumte Zeitungslektüre der vergangenen Tage zumindest ausschnittweise nachzuholen, bevor das Papier seiner letzten Bestimmung zugeführt wurde. Tückisch war Toilettenpapier aus alten Illustrierten. Die glänzenden Blätter sahen zwar schön aus, besaßen aber keine Haftfähigkeit. Um diesem Papier einen reinigenden Effekt zu verleihen, musste man es kräftig zwischen den Händen rubbeln. Dann wurde die Oberfläche griffig und konnte unliebsame Rückstände geschäftlicher Tätigkeit auf dem Plumpsklo aufnehmen.