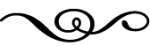Der Frühling hatte Nantes in diesem Jahr vergessen. Ein kühler Wind peitschte seit Tagen unerbittlich kalten Regen auf die Dächer. Granitgraue Wolken schoben sich vom Atlantik her über die Stadt.
Ungeduldig legte Julien Maxime Pinot die Zeitung beiseite. Die Gazette de France berichtete von weiter steigenden Getreidepreisen. Seit der Generaldirektor der Finanzen, Anne Robert Jacques Turgot, im September letzten Jahres den Getreidehandel liberalisiert hatte, kletterten die Preise stetig in die Höhe. Dazu kam die schlechte Ernte im vergangenen Sommer. Es waren aber nicht die hohen Getreidepreise, die ihm die Sorgenfalten auf die Stirn trieben, seine Gedanken kreisten immerwährend um seine „Marie Hélène“. Sollte sie nicht ankommen, stand ihm das Wasser bis zum Hals. Ja, er hatte es zu einem beträchtlichen Vermögen gebracht. Doch nun hatte er seine gesamte Habe in dieses Schiff investiert, das bereits vor einer Woche im Hafen hätte einlaufen sollen.
Die „Marie-Hélène“ war ein elegantes Schiff. Und das Wichtigste: Sobald das Werkzeug und die Musketen, der Schnaps und die Stoffe in Afrika ausgeladen wurden, fasste sie über dreihundert Neger. Mit dem Gewinn würde er eine weitere Schiffsladung Luxusgüter in Amerika laden können – und dazu zählte in diesem Jahr auch Getreide. Sein Kapitän sollte die dreihundert Sklaven gegen Weizen, Kaffee und Kakao eingetauscht haben. Diese Waren erzielten in Frankreich hohe Gewinne. Aber was, wenn sein prächtiges Schiff im Atlantik verschollen wäre? Es würde das Ende bedeuten. Er war erst vierzig. Angst stieg in ihm auf.
Ein Klopfen an der Türe seines Arbeitszimmers riss ihn aus seinen Gedanken.
„Ja?“, brummte er unfreundlich.
Langsam öffnete sich die Tür und vorsichtig schob sich ein siebenjähriges Mädchen herein, das kastanienbraune Haar zu Zöpfen geflochten, die kunstvoll den kleinen Kopf wie eine Krone umwanden.
„Gehen wir heute wieder zum Hafen, Papa?“
Augenblicklich besserte sich seine Laune. Er liebte Hélène wie keinen anderen Menschen. Außerdem kam ihm diese Abwechslung wie gerufen.
„Jetzt“, antwortete er, erhob sich von seinem Schreibtisch, um sich für den Spaziergang zum Hafen vorzubereiten.
Julien war groß gewachsen, die meisten Männer reichten ihm nur bis zur Nase. Sein ausgeprägter Unterkiefer verriet starke Willenskraft. Im Kontrast dazu strahlten seine dunklen Augen Milde und Gutmütigkeit aus. Vielleicht war es diese Verbindung aus Kraft und Güte, die schon viele Frauenherzen hatte höherschlagen lassen.
Obwohl der Hafen nahe genug für einen Fußmarsch lag, ließ Julien die Kutsche vorfahren. Clément, seit einer Ewigkeit Kutscher der Familie, saß stoisch auf dem Kutschbock, der Regen lief in Strömen von seinem Schlapphut. Schnell hastete Julien mit Hélène in den Wagen.
Maximilien war dreizehn und schon fast so groß wie sein Vater. Er saß bereits im Wagen, als Julien und seine Schwester einstiegen. Er half Clément, wann immer er konnte, mit den Pferden, und einen Ausflug zum Hafen wollte er sich auf keinen Fall entgehen lassen.
Nach zehn Minuten bog die Kutsche auf den Quai de la Fosse ein, jenen Teil des Hafens, wo die großen Handelsschiffe festmachten. Maximilien sah schon aus dem Fenster die ersten Masten, die im bewegten Wasser der Loire hin und her schaukelten. Eines Tages würde er an Bord eines solchen Schiffes in die Neue Welt segeln und dort Abenteuer bestehen, wie er sie oft von den Seeleuten hörte.
Mit einem Ruck kam die Kutsche zum Stehen. Julien drückte sich den schwarzen Dreispitz auf seinen großen Kopf, schob ihn tief in die Stirn. Er schlang den Mantel eng um sich, stellte den Kragen auf und griff nach der Tür.
Julien kniff die Augen zusammen, um trotz des Regens, den der Sturm ihm ins Gesicht blies, den Hafen überblicken zu können. Majestätisch lagen einige Handelsschiffe am Kai, schwankten, obwohl sie fest vertäut waren, in der Dünung heftig hin und her. Die „Marie Hélène“ war nicht zu sehen. Julien hätte sie sofort erkannt. Sie war schlanker als die meisten Handelsschiffe und bot mit ihren drei Masten genug Segelfläche, um die meisten Schiffe hinter sich zu lassen. Am auffälligsten war die geschnitzte Meerjungfrau am Bug, deren entblößter Oberkörper die Blicke der Seeleute auf sich zog.
„Papa, da kommt ein Schiff!“, hörte Julien seinen Sohn rufen. Julien blickte in den dichten Regenschleier hinaus – nun sah er es, immer deutlicher zeichneten sich die Umrisse eines Schiffes ab. Juliens Nerven vibrierten. Ungeduldig tastete sein Blick die Gestalt des Seglers nach bekannten Merkmalen ab. Jetzt konnte er den Bug erkennen – es war nicht die „Marie Hélène“. Es war nicht einmal ein Handelsschiff, sondern ein Kriegsschiff, eine Fregatte der königlichen Marine. Maximilien und Hélène winkten begeistert, Julien wandte sich enttäuscht ab. Wenig später hatte die Fregatte am Kai festgemacht und die ersten Offiziere balancierten, ungeachtet des Sturms, der wütend an ihren Mänteln riss, über den Landesteg. Julien ging auf die Männer zu und rief einen Leutnant an:
„Willkommen in Nantes! Haben Sie ein Handelsschiff, die ‚Marie Hélène‘ gesehen? Eine Meerjungfrau am Bug? Sie muss vor vierzig Tagen in Guadeloupe in See gestochen sein.“
„Es gab mehrere Unwetter und Piratenüberfälle in der Karibik. Aber ich weiß nicht, welche Schiffe betroffen sind, es tut mir leid“, antwortete der Leutnant und schickte sich an, weiterzugehen.
„Es gibt doch Aufzeichnungen bei der Marine, könnten Sie für mich nachsehen?“, fragte Julien flehend und drückte dem Offizier eine Münze in die Hand. „Schicken Sie mir Nachricht an diese Adresse.“ Julien steckte dem Leutnant eine Visitenkarte zu.
„Ich versuche, etwas herauszufinden, und schicke einen Matrosen“, versprach der Offizier und eilte seinen Kollegen nach.