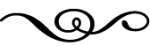Kegel Ripertus
Es war nicht weit von Spören bis zum Markt in Zörbig. Schwer schleppten Ripert und sein jüngerer Bruder am Brennholz. Die Riemen des Tragekorbes schnitten in ihre Schultern, links und rechts zogen ihnen Säcke mit Holz die Arme lang. Mutter trug ebenfalls einen solchen Korb auf dem Rücken, in den Händen hielt sie eine Holzschüssel mit frisch gepflückten Walderdbeeren. Dort, wo Holz verkauft wurde, stellten sie die Last ab. Bald kamen die ersten Kunden. Das Geschäft war nicht ertragreich, aber ein sicheres. Jede Familie brauchte Holz zum Kochen. Mit Erlaubnis des Vogts boten sie Trockenholz und Waldfrüchte zum Kauf an.
Die Mutter schimpfte, da sie weniger Erdbeeren als gewollt feilbieten konnte. Sie kannte eine Stelle im Wald, gut zwischen Buschwerk versteckt, wo diese leckeren Früchte wuchsen. Jemand hatte sie dennoch entdeckt und sich daran bedient. Ripert schaute bei ihrem Schimpfen gleichgültig drein, doch plagte ihn das schlechte Gewissen. Einem Mädchen aus seinem Dorf, dem seine Zuneigung galt, hatte er jene Stelle gezeigt. Mehrmals hatte er ihre nackte Haut am Oberarm berührt, sie sogar gestreichelt. Die Jungfer hatte nur gelacht und gemeint: „Lass das, Kegel, nicht einmal ein Bastard bist du“, und war weggelaufen. Dort im Wald hatten ihn weniger diese beiden Worte überrascht, er war enttäuscht, in seiner Ehre gekränkt, dass die junge Frau ihm lachend davonlief. Dafür hatte sie offenbar am Folgetag das Waldfleckchen mit den Erdbeeren geplündert. Das konnte er nicht verraten. Es war doppelt unangenehm.
Auf dem Markt hörte er, dass jenes Mädchen einem Jungen aus dem Nachbardorf versprochen worden sei. Gekränkte Eitelkeit kam in ihm hoch. Er dachte an die beiden Worte, die ihm die Jungfer an den Kopf geworfen hatte. Ja, was bedeuteten Kegel und Bastard? Plötzlich stand die Erdbeerdiebin an seinem Holzstapel, begleitet von einem jungen Mann. „Wie geht es dir, Kegel?“, fragte sie schnippisch und stellte ihm ihren künftigen Gatten vor: „Den hier werde ich heiraten, nicht so einen Hungerleider wie dich.“ Dieser lachte Ripert an und lästerte: „Na Kegel, die Erdbeeren waren nicht nur lecker, meine Braut verkaufte sie mit gutem Gewinn!“
Der Bruder erzählte Ripert, dass sich ihre Mutter mit jenem Mädchen unterhalten habe, das hier am Stand war und ebenfalls Erdbeeren anbot. „Ob sie etwas gemerkt hat?“, fragte er sich. Auf dem Rückweg nach Spören hielt die Mutter unerwartet in ihrem Lauf inne und forderte ihre Söhne auf, künftig vorsichtiger bei Werbeversuchen gegenüber einer Jungfer zu sein. „Sie oder ihre Familie nutzen mitunter jeden kleinen Vorfall, um Gewinn daraus zu schlagen. Manchmal kommen sie auf völlig abwegige Ideen. Es gibt immer dreiste Sippen …“ Bei diesen Worten schienen ihre Gedanken woanders zu sein. Die Erdbeeren waren vergessen.
Einige Tage waren vergangen, Gefühle für das Mädchen suchte Ripert zu unterdrücken, dafür wirbelten ihm die beiden Worte, Kegel und Bastard, umso heftiger im Kopf herum, doch er scheute sich, seinen Vater zu fragen. Seinem Gefühl nach verbarg sich hinter ihnen etwas Unangenehmes, ihr Klang war beleidigend, der Tonfall abwertend. Bald ergab sich eine Gelegenheit, den Vater nach dem Sinn dieser beiden Wörter zu fragen. „Eine Jungfer warf sie mir an den Kopf. Sie meinte, ich sei ein Kegel, nicht einmal ein Bastard.“ Der Vater sah seinen Ältesten erschrocken an, suchte offenbar nach Worten und erklärte endlich: „Ja, Ripert, die junge Frau hatte recht: Du bist ein Kegel.“ Instinktiv fühlte er noch deutlicher als zuvor, dass sich dahinter etwas Schlechtes verbarg. Auf seinen erstaunten Blick äußerte der Vater zögerlich, unwillig und beschämt, dass die Kinder eines Pfarrers unehrenhaft geboren seien. Mit Freigelassenen, Lohnkämpfern, fahrendem Volk, sogar mit jenen, die von Gericht überführt, Diebstahl und Raub sühnen, gehören sie dem untersten Stand an.
Ripert verschlug es die Sprache, die Worte blieben im Hals stecken, eine solche Aussage ausgerechnet von seinem Vater. Bisher hatte er recht sorgenfrei gelebt, es gab keinen Grund, in der Dorfgemeinschaft über seinen Stand nachzudenken.
Nach des Vaters Worten war ihm bewusst, wo er hingehörte: In der Rangordnung befand er sich ganz unten, auf dem Boden. Weiter hinab war nicht möglich! „Ich zähle zu jenen, auf die alle herabblicken!“, hämmerte es in seinem Kopf. „Jeder Bauer hier im Dorf, selbst die Landsassen, die sich bei anderen verdingen, stehen über mir! Mit Dieben und Übeltätern gehöre ich dem gleichen Stand an. Unglaublich! Das kann, das darf nicht wahr sein! Im Gegensatz zu dem künftigen Mann der Erdbeerdiebin besitze ich nichts. Der erbt eines Tages ein oder zwei Hufen Land, ich kann nicht einmal davon träumen! Tatsächlich, ich bin ein Hungerleider. Auf welcher Weise werde ich eines Tages ohne Eltern leben, wenigstens Nahrung beschaffen?“