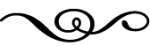Zu Beginn des Weihnachtsfestes 1697, zwei Tage vor dem verhängnisvollen Gelöbnis des Papiermüllers Körner, sah es in Wissfeld an der Brieg so aus wie jedes Jahr um die Heilige Nacht. Die Äcker lagen kahl und still, gelegentlich schreckte der Ruf eines Eichelhähers die Feldmäuse auf, und die Menschen blieben wegen der Dunkelheit in ihren Häusern und Höfen. Buchen, Erlen und Eschen standen unbelaubt an den Hängen, und die wenigen Fichten ragten wie dunkle Fahnen aus den Hügeln. Der Winter hatte bisher kaum Schnee gebracht, die Eisdecken auf den Pfützen blieben zerbrechlich. Die Häuser und Katen der Handwerker und Bauern rings um die Jakobuskirche lagen in friedlicher Feiertagsruhe, und nichts deutete auf das kommende Unheil hin. In der Stube des abseits gelegenen Wohnhauses oberhalb der Papiermühle, bei der siebenköpfigen Familie des Müllers Hans Georg Körner, brannte am Heiligabend ein helles Feuer im Kamin, und alle murmelten das Tischgebet vor dem guten Essen in jener oberflächlichen Dankbarkeit, die dem für selbstverständlich gehaltenen Wohlstand entspringt. Die kleine Überschwemmung, die sich an der Brieg abzuzeichnen begann, schien zu den gewöhnlichen Schwankungen des Wasserspiegels zu gehören, die jemanden, der am Fluss lebt, kaum aufregen.
Während der letzten Stunden des Heiligabends legte sich das Wasser in harmloser Weise um die Stämme der Weiden am Ufer. Von dort kroch es über die Äcker und bahnte sich im Lauf der Nacht unbemerkt den Weg ins Dorf, zuerst in Gestalt kleiner Pfützen in die Gärten hinter den Häusern. Als nächstes wand es sich als Bach über Wege und Plätze, über die Schwellen der Häuser und an den Eingang des Schulzimmers hinterm Pfarrhaus. Am Morgen des ersten Weihnachtstages besaß jedes neu entstandene Gewässer eine Strömung, die sich beschleunigte, je höher der Wasserspiegel wuchs.
Kaum einen Tag später schlugen die Fluten der Brieg jede bisher markierte Wasserhöhe. Niemand im Dorf, weder die Körners noch die weniger begüterten Familien, hatten eine Möglichkeit, sich zu wehren, niemandem blieb etwas anderes übrig als seine Habe zu sichern, zu warten und zu beten. Das Wasser drang in Wohnhäuser und Hütten ein und verscheuchte die Menschen von allen tiefer gelegenen Plätzen. Das Vieh brüllte angstvoll aus den Ställen. Vom Morgen des zweiten Weihnachtstages an stand Hans Georg Körner in seiner Mühle und musste mitansehen, wie das Wasser dem Gebäude auf dem sanft ansteigenden Fahrweg immer weiter entgegenkam. Er sah zu, wie unweit seiner Mühle die Kate von Bernt, einem seiner Tagelöhner, von Wasser eingekreist wurde, und er rief warnend hinüber, bis Bernts Frau sich endlich überzeugen ließ, mit dem jüngsten Kind im Arm durch das knietiefe Wasser zu entkommen. Nach Stunden des Widerstands brach die aus Lehm gemauerte Hütte zusammen, und Bernt stand mit seiner Familie ohne Dach über dem Kopf da.
Das Wasser drang zur Mühle vor, erreichte die Stufen vor der Tür, kletterte binnen weniger Momente daran empor und überwand auch die letzte von ihnen. Das Haus war nicht mehr zu schützen. Die Papiermühle stand nahe am Ufer, um die Kräfte des Wassers nutzen zu können, und dieser Aufgabe war der kleine Fluss mit dem Namen Brieg bisher jederzeit auf die erhoffte Weise nachgekommen. Er trieb seit dreiundzwanzig Jahren das schwere Wasserrad an, das die Hämmer des Stampfwerkes auf die Lumpentröge niedergehen ließ. Die Brieg, sonst ein friedliches Gewässer, wurde an diesem zweiten Weihnachtstag 1697 binnen weniger Stunden zu einem reißenden Ungeheuer.
Hans Georg Körner stand auf dem gestampften Lehmboden des Mühlraums, nicht bereit, seinen Platz zu verlassen. Unter der Türritze hindurch drang Wasser in den Raum, Körner sah es auf den Boden fließen und ansteigen und war nicht in der Lage, sich zu regen. Ebenso wenig wie Bernts Frau von ihrer Kate konnte er sich von der Papiermühle lösen, an der sein Herz hing.
Von Mittag an stand er mit beiden Stiefeln in der trüben Brühe, die durch seine Mühle floss, und fluchte. Die Flüche wären geeignet gewesen, eine gläubige Seele in Aufruhr zu versetzen, aber niemand konnte den Papiermüller hören und Körners gottlose Rufe wurden vom Brausen des Wassers übertönt. Es gab nichts, was er noch tun konnte, längst waren die Türen von innen mit Balken verkeilt, die Fenster vernagelt. Alles, was nicht zu schwer war, stand auf Tischen, Bänken und Fensterbrettern oder war auf den Dachboden geschafft worden. In der Mühle lag die Finsternis des verschlossenen Hauses als schwarzer Block, nur die Insel des flackernden Lichts aus seiner Laterne wanderte mit dem Müller. Draußen herrschte die tiefe Dezembernacht. Er war allein, hatte seine Männer heimgeschickt, jeder von ihnen musste sich in der Stunde der Not um seine eigene Familie kümmern. Das Hochwasser hatte sich an den meisten Orten still ausgebreitet, an der Mühle aber, wo das Wasser in einen Kanal geleitet wurde, brauste es von Anfang an laut. Das Rauschen des Flusses, sonst vom gleichmäßigen Rumpeln des Mühlrads begleitet, glich inzwischen einem barbarischen Tosen.
Zwei Stunden, nachdem das Lehmwerk der Tagelöhnerkate in den Fluten versunken war, brach die Nacht herein. Körners Frau Lindel hatte für Bernts Familie ein Lager in ihrem Stall bereitet, obwohl sie sich erst einmal um sich selbst hätte sorgen müssen. Sie war hochschwanger, im Februar erwarteten die Körners ihr sechstes Kind. Zum Jammern war Lindel nicht gemacht, ihre eigene Gesundheit war ihr in diesem Moment gleich. Sie schleppte Decken für Bernts Kinder heran und ließ die Mägde eine warme Suppe kochen. Samt des Jüngsten hatte Bernt acht Kinder, sagte man, aber Hans Georg Körner hätte beim Anblick der sonst quirlig herumstreunenden Bande nicht beschwören können, ob es nicht auch sieben oder neun sein konnten. Angesichts des Unglücks waren sie alle stumm geworden und folgsam wie Lämmer. Lindel war gutherzig, sie pflegte jeden kranken Spatz gesund und hätte nicht ertragen, wenn Bernts Familie die Nacht im Freien verbringen müsste. Wo auch? Jeder in Wissfeld bangte um sein Hab und Gut, sicherte seinen Besitz, schleppte Balken und Sandsäcke. Niemand hatte Platz übrig, weil jede vor dem Wasser sichere Stelle mit Kisten, Bänken und Tischen belegt war.
Der Papiermüller stand fast bis zu den Knien im Wasser. Er spürte die Nässe an seinen Beinen nicht, registrierte nicht einmal die Dunkelheit. Viel zu sehr traf ihn das Tosen von draußen, das die Balken seiner Mühle ächzen und stöhnen ließ. Er würde die Mühle nicht verlassen. Wenn sie so wie Bernts Kate in dieser Nacht zusammenbrach, dann wollte er mit ihr untergehen. Diese Mühle war sein Leben. Er hatte sie aufgebaut, als er ein junger Mann war, hatte sie mit allem, was er besaß, geschaffen und war jedes Risiko eingegangen, um seinen Traum von der eigenen Papiermühle zu erfüllen, und seitdem tat sie unentwegt ihren Dienst. Körner kannte jeden Balken, jedes Stück Mauer, jedes Zahnrad der Mechanik besser als seine Rocktasche. Er konnte sich ein Leben ohne diese Mühle nicht vorstellen.
Das schwere Wasserrad drehte sich so schnell, dass er meinte, es schreien zu hören. Der Wasserspiegel erreichte fast die Höhe seiner Achse, und wenn er dort angekommen war, würde das Wasser in die Mechanik eindringen. Das wäre der Tod der Mühle. Die Mechanik, ihr Herz, das den Pulsschlag vorgab, das ständige Hämmern, das er noch im Schlaf hörte, war von nichts so gefährdet wie von Hochwasser. Am Oberlauf der Brieg hatte es vor Jahren eine weitere Papiermühle gegeben, sie hatte den Tod durch ein Hochwasser erlitten und war nie wieder aufgebaut worden.
Körner zog die Stiefel durch das Wasser und bewegte sich auf die schwere Spindelpresse zu. Auch du, dachte er, auch du stehst mit den Füßen im Wasser und kannst genauso ertrinken wie ich. Wenn sie kommt, die Brieg, dann werden wir beide gemeinsam untergehen, nicht wahr?
Er lehnte sich an einen der offenen Balken des Fachwerks und ließ seinen Blick schweifen. Das Licht seiner Laterne, die er auf dem Balken abstellte, flackerte vom Luftzug. Das Fluchen hatte er eingestellt, seit einer Stunde war er stumm wie ein Fisch, und er begriff, dass es Zeit war, die letzte Instanz um Hilfe zu bitten.
»Herr Gott im Himmel«, Körner faltete die Hände, »ich bitte dich, ich flehe dich an, lass die Mühle stehen. Ich gelobe, dir zu dienen bis zu meinem letzten Tag. Alles, alles, will ich dir geben, o Herr! Verlange jedes Opfer von mir! Aber lass die Mühle stehen und mach mich nicht zu einem Bettler!«
In diesem Moment knackte es, und Körner meinte schon, der erste Balken würde sich aus seiner Verankerung lösen. Aber es war nur das Fenster zum Hang, das der einzige Weg in die Mühle war, wo er doch die Tür hatte verkeilen müssen. Die Fensterflügel öffneten sich und Barbara kletterte herein. Sie hatte die Röcke bis zu den Knien gerafft und trug Körners alte Stiefel. Ihr rotes Haar war vom Wetter zerzaust. Hinter ihr lag die Schwärze der Nacht, und der eisige Wind heulte. Obwohl es in der Mühle keine Wärmequelle gab, erweckte der Raum den Eindruck, noch immer Schutz zu bieten. Hans Georg Körner lief ein Schauer über den Rücken, weil das Fauchen des Sturms durch das geöffnete Fenster einzudringen schien.
»Vater!«, Barbara sprang vom Fensterbrett ins Wasser, dass es bis zu ihm hinüberspritzte. Das Wasser reichte ihr über die Knie und lief in die Stiefel.
»Mädchen, was machst du hier?«, fuhr Körner seine älteste Tochter an.
»Vater, du solltest nicht hier sein. Du kannst nichts ändern. Komm mit zurück ins Haus, da oben sind wir sicher.«
»Solange die Mühle nicht gerettet ist, gibt es für mich keine Sicherheit.«
Sie haschte nach seiner Hand, ergriff sie und hob sie an ihre Wange. »Du willst sie nicht im Stich lassen, nicht wahr?«
»Ich kann nicht, Barbara. Meinst du, ich könnte ertragen, oben am Fenster zu stehen und zuzusehen, wie sie zusammenbricht? Was hat mein Leben dann noch für einen Wert?«
»Es hat noch genauso viel Wert wie vorher, Vater. Für Mutter, für mich, für meine Geschwister samt dem einen, was bald kommt. Willst du uns alle im Stich lassen?«