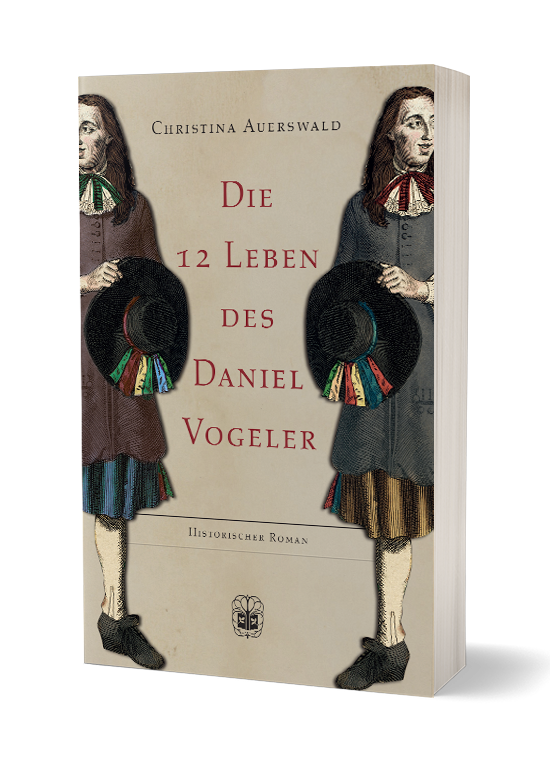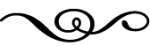Daniel Vogeler zögerte, nahm die Mütze ab und knüllte sie in der Linken, ohne es zu merken. Der Wind fuhr ihm durchs Haar und wirbelte eine der kastanienbraunen Strähnen herum, und die silbernen Fäden darin glitzerten in der schwachen Morgensonne. Er war kurz vor dem Ziel seiner Reise, aber im letzten Augenblick schienen seine Kräfte zu versagen. Marie hielt seine andere Hand. Eigentlich hätte er sie festhalten müssen, es war seine Pflicht als Vater, aber in Wahrheit war er in diesem Augenblick zu schwach für diese Aufgabe. Marie war seine Stütze, sein Halt, ohne sie hätte er es nicht einmal bis in diese Straße geschafft. Sie blieb neben ihm stehen und sah ihn fragend an.
An diesem Morgen im März 1715 blies der Wind nicht so kalt wie in jenem ersten Jahr, das er fern von hier verbracht und das ihn beinahe das Leben gekostet hatte. Überhaupt war der Wind im Norden ein anderer. Er blies stärker und landeinwärts. Die Luft trug den Geruch nach Meer und Salz mit sich, und am Ende des Winters brauchte es lange, ehe der Frühlings darin zu riechen war. Wo er heute wohnte, brachen in diesen Tagen die ersten Knospen auf, die Buschwindröschen entfalteten ihre weißen Blüten auf den federn-den Waldböden und die Amseln begannen zu jubeln. Hier noch nicht.
Daniel war trotz der Frühjahrskälte von Dresden hierher aufgebrochen, und er fragte sich erneut, ob er das Recht besaß, der zarten Marie die Beschwerlichkeiten dieser Reise zuzumuten. Sie waren die Elbe hinabgefahren, obwohl noch Reste von Eis auf dem Wasser lagen. Auf dem Schiff emp-fand man die Kälte stärker, denn die Feuchtigkeit trieb sie wie Nadeln in die Knochen. Der frostklirrende Wind zwang die Passagiere, die meiste Zeit unter Deck zu verbringen, wo es eng war und nach Rattenkot stank. Sie hatten das Schiff im Hamburger Hafen erst vor einer Stunde verlassen, und da sie mit wenig Gepäck reisten, brauchten sie die Entladung der Fracht nicht abzuwarten. Vom Pier waren sie zu Fuß in die Stadt hineingegangen, zwischen den Türmen der Kirchen, den Fassaden von Lagerhäusern und Wohnhäusern aus rotem Backstein hindurch bis ins Petriviertel, bis in die Straße, deren Staub er vor dreiunddreißig Jahren zum letzten Mal von seinen Schuhen gewischt hatte.
Daniel konnte sich vom Anblick des verwitterten dreistöckigen Hauses nicht lösen. Dreißig Schritte entfernt war er stehengeblieben, obwohl der Wind blies und Maries Kleid um ihre Beine wehte. Vor seiner Tochter durfte er sich keine Blöße geben. Er würde sich entscheiden müssen, ob er hineinging oder nicht, und wenn er ging, musste er mit ihr gemeinsam gehen. Sie würde alles hören und bei allem zusehen, was in diesem Haus geschah.
Es mochte sein, dass sie in wenigen Augenblicken, wenn drinnen die Sache auf den Tisch kam, die Achtung vor ihm verlor oder schlimmer, dass sie ihn verabscheute, dass sie sich auf dem Absatz umdrehte und einfach fortging. Es mochte auch sein, dass es gut endete, aber er hatte keine Vorstellung, was gut in diesem Fall bedeutete. Sicher blieb, dass es ein Ende haben musste, so oder so.
Der Anblick des Hauses presste seine Brust so sehr zusammen, dass er kaum atmen konnte. In den letzten Wochen hatte er sich mehr denn je gefragt, was daraus geworden war, aber nie ohne das drückende Gefühl von Schuld zu empfinden. Er hatte erwartet, es zerstört oder eingefallen zu sehen, verkauft, umgebaut, verschandelt. Seit er das letzte Mal durch diese Tür getreten war, mussten dre-unddreißig Jahre ihre Spuren hinterlassen haben, sowohl an diesem Haus, als auch an den Menschen, die darin gelebt hatten.
Aber an seinem Elternhaus schien die Zeit vorüber-gegangen zu sein, ohne es zu berühren. Es sah aus, als wäre eben die Morgenröte jenes 15. Juli 1682 aufgezogen, als hätte er gerade die Tür vorsichtig hinter sich zugezogen, um nicht das kleinste Geräusch zu erzeugen. Die grünen Fensterläden waren geöffnet, die kleinen Scheiben der geteilten Fenster blinkten im Morgenlicht, die glatten Schindeln deckten das spitze Dach lückenlos. Dreiunddreißig Jahre waren eine lange Zeit im Leben eines Menschen. Daniel war nicht mehr vierzehn Jahre alt. Er war siebenundvierzig.
Vieles war geschehen. Ein Mann von siebenundvierzig weiß um die Endgültigkeit von Entscheidungen und dass eine jede Konsequenzen hervorruft. Der vierzehnjährige Daniel, den er noch immer in sich spüren konnte, wusste das nicht. Vor ihm lag die Welt offen und bestand aus einer Ansammlung von Möglichkeiten, die zu ergreifen er nur die Hand ausstrecken musste. Das Recht, Schwierigkeiten aus dem Weg zu gehen, wog schwerer als die Leiden anderer. Einen Vierzehnjährigen kümmert nicht, ob sein Weggang eine Flucht ist; es ist ein Schritt in die Zukunft. Ein Vierzehn-jähriger will leben; er meint, alle Verantwortung aus-schlagen zu dürfen.
»Ist das das Haus, in dem du geboren wurdest, Vater?«, hörte er Marie fragen. Marie sprach wenig, aber sie erfasste alles rings um sich mit Feingefühl. Sie hatte sich in seinen dunkelsten Stunden auf den Stuhl neben sein Bett gesetzt. Nachdem er ihr gestanden hatte, dass ihn eine alte Schuld quälte, hatte sie lediglich gefragt, wann sie fahren würden. Seine Tochter verstand ihn ohne viele Worte.
Vor jener dunklen Nacht hatte er niemals erwähnt, dass er von hier stammte. Er redete nie über Vergangenes. Seine Stimme hatte den norddeutschen Klang längst verloren, und kaum jemandem gegenüber erwähnte er seine Kindheit. Lene kannte ein paar Fakten, aber selbst ihr hatte er nur von seinem Irrweg erzählt und nicht von dessen Beginn, der Nacht auf den 15. Juli 1682.
Daniel stieß den Spazierstock in den Staub der Straße. Er ging niemals ohne einen Spazierstock, der nach der neusten Mode gemacht war. Derzeit waren schwarze Stöcke mit Silberbeschlag am beliebtesten. Dass er mit einem Stock ging, hatte mit diesem Haus zu tun, und dass ihm die Verbindung zu Bewusstsein gekommen war, verdankte er seltsamerweise einem Hochwasser der Elbe im Jahr zuvor.
Daniel fühlte die Schuld auf seiner Brust liegen wie eine Zentnerlast. Es musste ein Ende haben. Viel zu lange waren die schlimmsten Erinnerungen so tief vergraben gewesen, dass sie nur als dumpfe schwarze Masse auf sein Herz drückten, bis sie sich ihren Weg als Traum bahnten. Der Traum war ein Wolf gewesen, ein gespenstischer, bedroh-licher Wolf.
Nun stand ihm wieder alles vor Augen. Er wusste noch, welche Farbe die Jacke gehabt hatte, die er an jenem Morgen anzog. Sie war braun gewesen, mit einer schwarzen Kante; einen Flicken auf dem Ellenbogen hatte er einer Prügelei auf dem Schulhof zu verdanken. Um den Hals trug er das grüne Tuch wie jeden Tag. Er sah die Möbel im Schreibzimmer seines Vaters vor sich, den dunklen Schrank mit den Büchern, den Tisch, die schweren Stühle und die Geld-kassette auf dem Tisch, leer bis auf einen einzigen Groschen. Er roch noch den allgegenwärtigen Weizen, als würden die Säcke, mit denen sein Vater zu Hunderten handelte, im Haus lagern und nicht in den Speichern am Hafen.
»Ja«, er nickte Marie zu, »in diesem Haus bin ich geboren.«