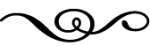»Wie kannst du mit dem Kind hier auftauchen? Du bist Jesuit! Geweihter Priester! Sollen es alle wissen?«
In Signora Cavallaris Miene stand Ärger. Der Siebenjährige hob den Kopf und sah seinen Vater fragend an. Die Dame hatte Italienisch gesprochen. Diese Sprache verstand der Junge nicht, aber ihre Miene war auch ohne Worte zu deuten.
Stefano ließ die Hand auf seiner Schulter liegen. »Willst du mich nicht erst einmal willkommen heißen, Mutter? Wir haben uns acht Jahre nicht gesehen. Ich wollte nicht mit Vorwürfen begrüßt werden.«
Die Signora trat zur Seite und wies in den Salon, wo zwei gepolsterte Ruhebänke einander gegenüberstanden, im Rücken hunderte von Büchern in dunklen Wandregalen. Es war die Bibliothek seines verstorbenen Vaters. Stefano trat ein, schritt mit seinen schmutzigen Schuhen über den Marmorboden und stellte das Gepäck neben eine Alabastersäule mit der Büste irgendeines Philosophen. Er sah sich um. Nichts hatte sich verändert, alles sah aus, wie er es seit seiner Kindheit kannte und wie es bei seinem letzten Besuch ausgesehen hatte, nur die Fenster waren nach der letzten Mode vergrößert und neu verglast worden. An diesem Maitag floss das Licht strahlend herein und zeichnete jede Kontur mit scharfem Riss. Hier hatte er vor acht Jahren von seiner Mutter Abschied genommen. Hier hatte sie ihm vom Geheimnis ihrer Familie erzählt, davon, warum sein Großvater in der Familie Cavallari geächtet gewesen war und dass er dessen Vornamen bekommen habe. Ohne sich auf die Ruhebank zu setzen oder die Hand von der Schulter des Jungen zu nehmen, fragte er: »Weißt du noch, Mutter? Du hast vor acht Jahren gesagt, dass du mich meinen Weg gehen lässt, welcher es auch sei.«
»Den Weg eines Jesuiten, ja. Du solltest das Vermächtnis deines Großvaters erfüllen und tun, was er nicht tun konnte. Er wäre gern Jesuit und Priester geworden, wenn er nicht die Entscheidung für meine Mutter getroffen hätte.«
»Du glaubst bis heute, ich sei dazu bestimmt, die Schande auszuwetzen, nicht wahr?« Die Bitternis in Stefanos Tonfall konnte seiner Mutter nicht entgehen.
»Jedenfalls nicht dazu, seiner Schande eine neue hinzuzufügen.« Signora Cavallari sah das Kind nicht an, während sie sprach, aber Stefano erkannte genau, was sie meinte.
Seine freie Hand ballte sich zur Faust. »Du bist die Tochter eines Mannes, der beinahe Jesuit geworden wäre, aber dann seinem Herzen gefolgt ist. Ausgerechnet du willst mir sagen, dass ich meinem Herzen nicht folgen soll?«
Sie blieb eine Weile stumm, dann wanderte ihr Blick an seinem Arm entlang zu dem Jungen. Der kleine Stefan hielt ihrem Blick stand. Er hatte dieselben tiefschwarzen Augen wie sein Vater; ihm umgab die gleiche Aura, die jeden dazu zwang, ihn zu betrachten. Die Signora seufzte und antwortete in weicherem Tonfall: »Sprich nicht von Herzen, darum geht es nicht. Du bist geweihter Priester. Das war mein Vater noch nicht, als er sich entschied. Wie konntest du dich dermaßen vergessen?«
»Wenn es irgendeine Möglichkeit gäbe, Mutter, sowohl geweihter Priester als auch Ehemann und Vater zu sein, ich bin sicher, mein Großvater hätte sie ergriffen. Und ich auch.«
Die Stimme der Signora war wieder so hart wie zuvor. »Was ist mit der Mutter des Kindes? Hockt sie hinter der nächsten Ecke? Wolltest du mit dem Kind mein Herz erweichen, damit ich sie aufnehme?«
Stefano schluckte. »Sie ist tot.«
Signora Cavallari wandte sich ab und senkte den Kopf. Die starre Miene löste sich, Stefano erkannte Regungen in ihrem Gesicht, wie er sie selten gesehen hatte, Mitgefühl, Ärger, Erleichterung. Am Ende blieb das Mitgefühl, als sie sagte: »Jetzt müsst ihr euch aber erst einmal ausruhen. Ihr habt eine lange Reise hinter euch.« Sie tat zwei Schritte zur Tür, öffnete sie und rief hinaus. Er hörte sie bei einer Magd Limonade für das Kind und einen Wein für ihren Sohn ordern. Ihr Blick war so ausdrucklos wie vorher, als sie sich zurückwandte und die beiden zum Setzen aufforderte. Stefano ließ sich nieder, der Junge tat es ihm nach, still, mit einem prüfenden Blick auf seinen Vater.
Agneta Cavallari auf ihrem Stuhl sagte dünn: »Als ich dir die Nachricht nach China gesandt habe, dass in Polen eine Frau ein Kind von dir bekommen hat, glaubte ich an ein Geheimnis. Es sollte eins bleiben.«
Stefanos Mundwinkel schoben sich ein winziges Stück nach oben. »Gerade du müsstest wissen, dass Geheimnisse schlecht für die Seele sind.«
Sie sah ihn mit einem Flackern im Blick an. »Es gibt Dinge, die man niemals aussprechen darf, Stefano. Wir haben alle gewusst, dass du früher oder später deinen Trieben erliegen wirst. Gott wird es dir verziehen haben. Dass die Sache Folgen hatte, kann man nicht mehr ändern. Ich habe dir nach China geschrieben, damit du bereust und für das Kind betest. Hätte ich geahnt, zu was du dich hinreißen lässt, dann hätte ich das bleiben lassen. Ich dachte, die Sache bleibt unter uns und die Moniuszkos kümmern sich um das Kind. Jetzt kommst du nach Rom und setzt uns einem solchen Skandal aus! Du zeigst den Beweis deiner Sünde aller Welt! Einen Sohn, der so heißt wie du, damit auch der letzte Esel begreift, welche Schande du auf dich geladen hast!«
»Den Namen habe nicht ich ausgesucht, sondern die Mutter des Jungen. Die Moniuszkos haben sie bei sich aufgenommen, das ist richtig. Aber wenn ein Kind keine Mutter hat, kann der Vater es nicht seinem Schicksal überlassen. Ich dachte, du würdest einem mutterlosen Kind gegenüber ein gutes Herz zeigen.«
»Aber ja doch, das werde ich.« Die Signora errötete.
»Sei beruhigt, niemand nennt ihn Stefano. Du kannst ihn Stjopa nennen. In den ersten Jahren seines Lebens ist er in Russland aufgewachsen; später in Warschau haben sich alle daran gewöhnt, ihn so zu nennen. Es ist das russische Kosewort für Stefan, darauf hört er am besten. Würde es dir etwas ausmachen, wenn wir polnisch sprechen? Das versteht Stjopa.«
Signora Cavallari ließ ihren Blick auf dem Jungen ruhen und sagte auf Polnisch: »Willkommen in Rom, Stjopa. Ich bin deine Großmutter.«