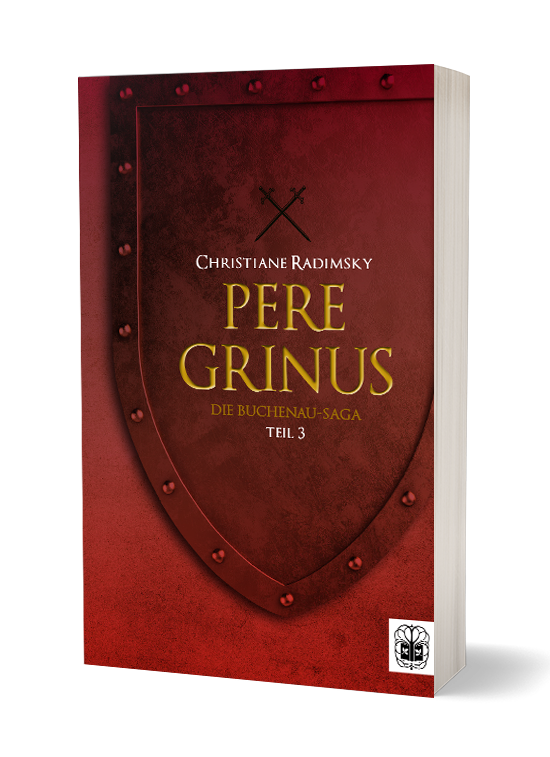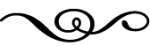Orientierungslos irrte ich durch die engen Gassen. Diese endete jählings an einem Kanal, dessen brackiges Wasser in Wellenbewegungen auf die Gosse schwappte. Ich drehte um und bog in eine breitere Gasse ein. Auf halber Strecke bedeckte vermoderndes Stroh den gesamten Weg vor mir. Es war wohl von dem windschiefen Dach darüber heruntergefallen. Ich raffte den langen Mantel hoch und stieg vorsichtig darüber, als unversehens eine Ratte mit räudigen Ohren unter dem Stroh hervorsprang und mir über die Füße lief. „Pfui Teufel!“ Angeekelt sah ich zu, wie sie mit weiten Sprüngen davonrannte.
Erneut änderte ich die Richtung und entschied mich für eine befestigte Straße, die nicht so verschmutzt war. Ich hoffte, dass sie mich aus dem Armenviertel herausbrachte, aber sie führte mich immer tiefer hinein. Kleinhändler tummelten sich auf einem sonnendurchfluteten Platz und priesen ihre armselige Ware lautstark an. Ärmlich gekleidete Weiber, die dieselbigen in Augenschein nahmen, versperrten den Weg und machten sich nicht die Mühe, mich durchzulassen. Schließlich nahm ich meine Ellenbogen zu Hilfe, um mich durch die Menge zu wühlen. „Dannatio!“, schrie ein eingeschrumpeltes Wesen mit schriller Stimme. Es beschützte mit ausgebreiteten Armen töpferne Waren, die sich direkt vor meinen Füßen auf dem Boden stapelten. Ich hob begütigend die Hände und stieg vorsichtig über die Töpfe hinweg.
Missmutig lief ich weiter. Es fiel mir schwer, mich zu orientieren, da fast alle Straßen und Gassen entlang von Kanälen zu führen schienen, die wiederum alle gleich aussahen. Eine Tür vor mir stieß unversehens auf, und ich trat eilig beiseite. Saurer Bierdunst strömte heraus, eine schwankende Gestalt stolperte hinterher und rempelte mich dabei unsanft um. Anstatt sich zu entschuldigen, rülpste sie laut und torkelte dann grölend weiter. „Der räudige Hund soll in der Hölle schmoren!“, schrie ich ihm hinterher und rappelte mich wieder auf. Dabei übersah ich einen Haufen Fäkalien, in den ich prompt hineintrat. Mit einem schmatzenden Geräusch zog ich meinen linken Stiefel heraus. Auch das noch! Vor mich hinfluchend rieb ich den abgewetzten Stiefel an einem Büschel Gras ab, das am Kanalrand wuchs, aber sauber wurde er nicht.
Meine Laune war auf dem Tiefpunkt angekommen. Ich irrte in einer fremden Stadt herum, war durstig und schwitzte und wurde dazu von Einheimischen angerempelt und beschimpft. Wenn ich das richtige Stadtviertel nicht fand, musste ich meinen Plan aufgeben und zurück zur Deutschordenskommende. Das wollte ich auf keinen Fall.
Endlich konnte ich die belebte Straße auf einer wackligen Holzbohlenbrücke überqueren, die den Kanal überspannte. Die Wohnstätten auf dieser Seite waren aus Ziegelsteinen erbaut und sahen gepflegter aus. Ein Bürgersweib mittleren Alters trat aus einem Haus, schaute nach rechts und links und lief zielstrebig los. Ich folgte ihr, und wie ich gehofft hatte, führte ihr Weg zu einer gepflasterten Straße. Sie flankierte einen Kanal, an dessen Ende eine gedrungene Backsteinkirche zu sehen war. Hoffnungsvoll ging ich hinein. Der Geistliche, den ich fragen wollte, wo sich die Kirche San Marcuola befand, war aber nicht im Kirchengebäude und die Anwohner verstanden mich nicht. Immerhin stand ein öffentlicher Brunnen auf dem Kirchplatz. Ich zog am Seil einen Eimer mit Wasser herauf, trank durstig aus der hohlen Hand und füllte meinen leeren Wasserschlauch auf. Nach kurzem Zögern wusch ich mir das erhitzte Gesicht, den Hals und die Oberarme mit dem erfrischend kühlen Wasser. Verflixt! Es konnte doch nicht so schwer sein, die besagte Kirche zu finden, zu deren Pfarrbezirk das Haus der Familie Vendramin gehörte. Ich hockte mich auf eine Stufe der nächsten Brücke und nahm den breitkrempigen Hut ab, um mir damit Luft zuzufächeln.
Mhm, was sollte ich tun, wenn ich das Haus fand, aber die Familie sich weigerte, mich zu empfangen? Ich kam ins Grübeln. Was, wenn Guidos Schwester nicht wusste, wo er jetzt lebte? Ich hätte doch gleich nach Bologna aufbrechen sollen. Hätte, hätte, jetzt war es zu spät dafür. Ein junges Weib mit einem Kleinkind an der einen und einem großen Weidenkorb in der anderen Hand beanspruchte die ganze Breite der Treppe und beschimpfte mich lautstark. Verstehen konnte ich sie nicht, aber ihr streitlustiger Gesichtsausdruck war eindeutig. Daheim hätte ich den Bürgern unmissverständlich klargemacht, wer der Herr war und was ich von frechen Weibsleuten hielt. Hier war ich nur ein armer Pilger ohne Bürgerrechte. Übellaunig gewährte ich ihr Durchlass. Wenn mich nur jemand verstehen könnte. Hier sprach man einen anderen Dialekt als in Bologna und Latein konnte natürlich keiner der Bürger. Ich schleppte mich weiter, bis eine weitere Kirche in Sicht kam. Mittlerweile hatte ich zwei Dutzend Kirchen und Kapellen gezählt, an denen ich vorbeigegangen war. Auch diesmal erwartete ich nicht, dass der Geistliche mich verstand, aber ich hatte Glück.
„Et cum spiritu tuo“, erwiderte der ältliche Priester im braunen Habit der Franziskaner meinen Gruß. Ich fragte ihn auf lateinisch, ob er vielleicht die Familie Vendramin kenne. Der Franziskaner riss die Augen auf. „Was willst du von der Familie, Peregrinus? Willst du etwa Handel mit ihnen treiben?“ Er musterte mich abfällig.
„Nein, ich bin ein guter Freund von Frau Cecilias Bruder. Ich bin mit Deutschordensrittern über die Alpen gezogen und möchte sie zuerst besuchen, bevor ich weiterreise.“
„Du bist mit den reichen Deutschrittern gereist, hast du gesagt?“
„Der Konvoi hat gestern Abend in der Stadt angelegt.“
Der Franziskaner nickte zustimmend. „Ja, das hat sich herumgesprochen. Wenn du in den Stadtteil Cannaregio gelangen willst, musst du dich am nächsten Abzweig rechts halten, am Kanal wieder links, über die gebogene Brücke, dann geradeaus, bis …“ Seine Erklärungen zogen sich in die Länge und ich bat ihn mehrmals, langsamer zu reden, um mir alles merken zu können. Er hielt schließlich inne. „Du bist noch nie in unserer Stadt gewesen, oder?“ Ich schüttelte verneinend den Kopf. „Ich denke, ich gebe dir besser eine Begleitung mit“, erwiderte er. „Dir ist hoffentlich klar, dass die Familie Vendramin eine alteingesessene und wohlhabende Kaufmannsfamilie ist?“
Er musste mich für einen einfachen Pilger oder Ministerialen halten, sonst würde er mich nicht duzen. Die beengte Deutschordenskommende, die alle Marburger Brüder willkommen geheißen hatte, besaß nur zwei Badezuber, die zunächst für die Deutschordensritter vorbehalten waren. Da die Bütten auch heute Morgen von den Reisekameraden besetzt waren, war ich wohl oder übel verdreckt und unrasiert aufgebrochen, ohne mein Schwert, das mich als Mitglied des Adels zu erkennen gab.
Erfreut stimmte ich dem Angebot des Ordenspriesters zu, der daraufhin in einem nahen Haus verschwand. Kurze Zeit später stolperte eine junge Magd heraus und wischte sich die mehligen Hände an der Schürze ab. Der Franziskaner hatte sie wohl direkt aus der Küche geholt. Unwillig vor sich hinmaulend rannte sie über enge Brücken, breite Straßen und an einer prächtigen Kirche vorbei, sodass ich kaum mit ihr Schritt halten konnte. Nach kürzester Zeit standen wir vor einem beeindruckenden Gebäude mit Balkonen im zweiten und dritten Geschoss und bunten Schnitzereien an den Fensterrahmen. Sie klopfte mit dem Handknöchel gegen das Portal und streckte mir dann auffordernd die offene Handfläche hin. Natürlich, sie wollte bezahlt werden. Ich kramte in meinem Beutel und suchte eine kleine Münze heraus, den sogenannten Piccolo. Zum Glück hatte ich gestern Abend, bevor ich mich auf dem zerfledderten Strohsack niedergelassen hatte, daran gedacht, einen Teil meiner Hersfelder Silberpfennige in die lokale Währung eintauschen und mir deren Wert erklären zu lassen. Die Magd sah mich verächtlich an, stopfte sich die Münze in die Tasche und eilte davon.
Ich hatte es geschafft und stand vor dem Haus von Guidos Schwester Cecilia! Nervös schüttelte ich den Staub aus dem Pilgermantel und rubbelte etliche hässliche Flecken vom Saum. Meine Stiefel waren komplett verdreckt, da war nichts mehr zu machen. Der breitkrempige Pilgerhut war ebenso staubig. Ich klopfte ihn aus, drückte meine an der Schläfe abstehenden Haare fest an den Schädel und stülpte den Hut wieder auf. Da nichts geschah, hatte die Magd offensichtlich nicht kräftig genug geklopft. Ich versuchte es erneut, aber diesmal lauter. Die Tür öffnete sich mit einem Ruck. Ein pockennarbiger, kahlköpfiger Mann füllte die Türschwelle aus und sah mich fragend an. „Si?“
Ich hüstelte nervös. „Ich möchte Frau Cecilia sprechen, ich bin ein Freund ihres Bruders Guido Guinizelli.“ Gedankenlos hatte ich im Bologneser Dialekt gesprochen. Der Mann musterte mich erstaunt von oben bis unten und schüttelte dann den Kopf. „Donna Cecilia ist schon lange tot.“
Er sprach den breiten Dialekt der Bologneser Bürger, welch ein Glück. Was hatte er gesagt, Guidos Schwester war tot? Daran hatte ich nicht gedacht, dass seine jüngere Schwester gestorben sein könnte. Unschlüssig kratzte ich mich am Kopf. Der Kahlköpfige war im Begriff, die Türe wieder zu schließen, als ich zur Besinnung kam. „Warte einen Moment. Ich suche meinen Freund Guido Guinizelli, mit dem ich vor Jahren in Bologna an der Universität studiert habe. Weißt du, wo er lebt?“
„Was willst du von Don Guido? Er ist von adliger Abkunft und kennt sicherlich keine abgerissenen Pilger wie dich. Schleich dich davon, oder ich lasse die Hunde auf dich hetzen.“
„Ich bin Ritter Erkenbert von Buchenau und gestern mit den Marburger Deutschordensbrüdern angekommen. Als reumütiger Pilger bin ich auf dem Weg ins Heilige Land.“ So hochmütig, wie ich es in meiner jämmerlichen Aufmachung vermochte, baute ich mich vor dem Pockennarbigen auf. Er veränderte seine Haltung und neigte seinen grindigen Kopf. „Seis gegrüßt, Miles Erkenbert. Wenn Ihr möchtet, frage ich Donna Matilda, die Tochter meines Herrn, ob Sie Euch empfängt. Don Roberto ist momentan auf Reisen.“