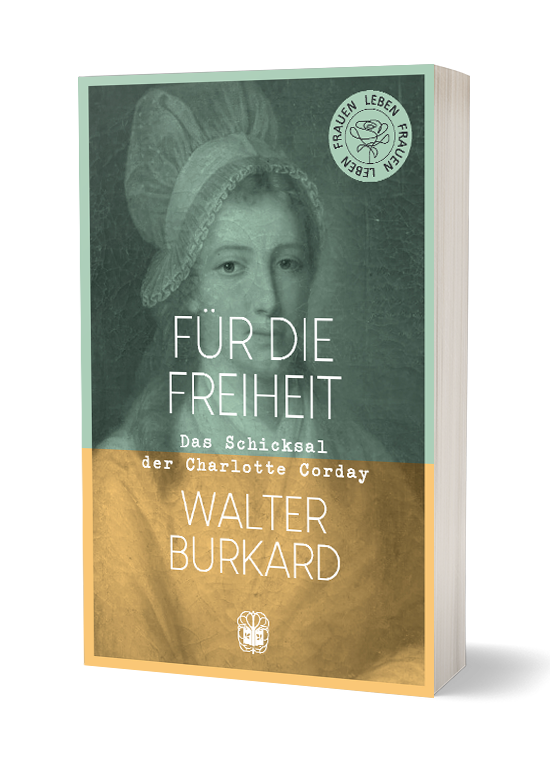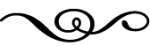Charlotte saß in der Nähe des Tümpels auf einer in die Gartenmauer eingelassenen Steinbank. Sie saß schon sehr lange da; seit dem Morgen, als man sie früher als sonst geweckt, hastig mit einer Schnitte Brot in den Garten geschickte hatte. Manchmal strich sie das tiefbraune Haar, das in der Sonne kastanienrot schimmerte, über die Schulter zurück; dann neigte sie auch den Kopf ein wenig zur Seite, als ob sie nach dem stillen Haus hinüberlausche. Aber es war nichts zu hören.
Ihr Blick ruhte auf einer zartgrünen Smaragdeidechse, die reglos auf dem glatten glühheißen Steinvorsprung verharrte. Eindringlich betrachtete sie die durch die kleine Wendung des schlangenhaften Köpfchens hervorgerufene Halsbeuge, wo unter der pergamenten gestrichelten Haut das winzige Herz pochte.
Jetzt hob Charlotte den Kopf; sie glaubte, aus dem Innern des Hauses einen unbestimmten Laut vernommen zu haben. Mit ängstlicher Gespanntheit blickte sie zum Portal hin, dessen hohe Doppeltür weit geöffnet war. Durch die braune Dämmerung des Flurs schimmerte eine offenstehende Eichentür als verschwommener Fleck. Auf der obersten Stufe der mit geschweiftem Geländer unter das Vordach hinaufführenden Treppe saß eine Katze in feier-licher Langweile. Die gelben Vorhänge der schmalen, fast bis auf den Boden gehenden Fenster waren zugezogen. Alles war wieder still.
Charlotte seufzte. Ihre Hände lösten die Brustschleife des steifleinenen Kittels und banden sie wieder — unablässig. Eine schreckliche Unruhe hatte von ihr Besitz ergriffen. Sie spürte, dass diese Stille eine schlimme Bedeutung haben müsse.
‚Was mag da drinnen nur geschehen? Es ist etwas, wobei man Kinder nicht brauchen kann! Gestern hat Tante Ivette Bruder Alexis und den kleinen François mitgenommen nach Bissière. Und heute Morgen kam sie schon wieder zurück und lief gleich in Mamas Zimmer. Die arme Eleonore muss sogar bei der komischen Tante Bretteville in Caen bleiben! Und mich schicken sie den ganzen Tag in den Garten. Als ob ich nicht wüsste, dass Mama krank ist, sehr krank sogar. In letzter Zeit ist sie doch fast immer krank und liegt sehr oft im Bett. Heute Morgen durfte ich zum ersten Mal nicht zu ihr hinein, nur von der Tür aus kurz ins verdunkelte Zim-mer blicken. Papa saß am Bett und bemerkte mich gar nicht. Ganz ruhig lag sie da und sagte mir nicht einmal Guten Morgen. Ob’s diesmal wirklich sehr schlimm ist? Marie sagt, es wäre sehr schlimm. Aber darauf gebe ich nichts, die hat ja schon vor einem Schnupfen Angst und wickelt uns in ihre scheußlichen heißen Tücher. Ach Gott, Mama! Liebe Mama! Wie hab ich dich so lieb! Wenn du auch eine sehr merk¬würdige Mama bist!
Wie streng sie oft ist! Dann duldet sie es nicht, dass wir sie umarmen und küssen. Ganz ernst wird sie da und schiebt einen zur Seite. Als fürchte sie sich vor etwas. Ich glaub, sie mag es nicht, wenn man ihr sehr nahekommt. Neulich bei unserem letzten Spaziergang hab ich es deutlich beobachtet. Wir gingen alle in Richtung La Ronceray, und da, wo es ein bisschen ansteigt, reichte Papa ihr den Arm. Ganz genau hab ich gesehen, dass sie es nur ungern geschehen ließ, obwohl sie das Gehen sehr anstrengte. Die ganze Zeit hielt sie ihren Arm so, dass Papa ihr nicht näher-kommen konnte als unbedingt notwendig. Und küssen tun sie sich nur ganz selten. Höchstens flüchtig auf die Stirn. Das verstehe ich aber sehr gut. Von einem Mann will ich nämlich auch nicht geküsst werden.
Mama liebt uns trotzdem. Jawohl, ich weiß es ja sogar ganz genau, dass sie uns Kinder sehr liebhat. Noch nicht lange, da lag ich abends noch wach im Bett, als sie herein-kam. Ich schloss schnell die Augen, und gleich darauf fühlte ich einen Kuss auf meiner Stirn. Über jedes Bett neigte sie sich und küsste die Schlafenden … Warum weint sie nur so oft? Manchmal steht sie plötzlich auf, geht in ihr Zimmer und kommt nach zehn Minuten wieder heraus. Ich sehe ihr aber an, dass sie geweint hat. Ihre Augen sind so schön! Sie ist überhaupt schöner als alle anderen Frauen. Am schöns-ten sieht sie aus, wenn sie am Clavichord sitzt und ihren ge-liebten Rameau spielt und dabei lächelt. Jeden Mittag im verdunkelten Salon beim matten Schein der beiden Leuch¬ter. Manchmal, ganz selten, nimmt sie mich mit hinein, weil ich doch auch schon spiele, nur nicht so gut. Dann spielt sie immer das eine Menuett, als gäbe es nichts anderes als Philipp Rameau. Neulich hat mir Tante Ivette mit ihrer Krähstimme etwas aus „Iphigenie“ vorgesungen. Mama darf das nicht wissen. Ich glaube, sie ist Gluck böse, weil er es doch war, der ihren Rameau in Paris entthront hat. Alle Welt, sogar in Caen, schwärmt von Gluck, nur Mama nicht. Gestern hat sie zum ersten Mal ihr Menuett nicht gespielt. Und heute auch noch nicht. Lieber Gott, lass sie doch gleich zu spielen anfangen!‘
Eine schlimme Ahnung durchzuckt das Kind im gleichen Augenblick, als vom Haus her aus dem Buchenwäldchen ein kühler Luftzug zu wehen beginnt. Gleichzeitig, als sei es von diesem Wind herangetragen, erscheint das zweirädrige Wägelchen des Doktors im Hoftor, zum zweiten Male heute schon. Charlotte bemerkt es mit wachsender Unruhe. Auf einmal überfällt sie panische Angst. Sie springt auf und läuft den Laubengang entlang auf das Haus zu. Da trägt der kleine Luftzug die ersten Takte des Menuetts herüber.
‚Endlich! Endlich! Sie spielt wieder ihren Liebling! Mama ist wieder gesund!‘
Doch an der Treppe bleibt sie stehen, lauscht erneut.
‚Das ist nicht Mama! Nein! Das ist gar nicht Mama!‘
Unsicher und schwerfällig holpert die Melodie dahin, wird abgebrochen, fängt wieder von vorne an, wird lang-samer, stockt.
„Mama!“, schreit das Kind auf und noch einmal, hoch und schrill, ,,Mama!“
Mühsam fängt das Spiel noch einmal von vorne an, quälend langsam, seelenlos. Die linke Hand bricht ab; wieder, zum vierten Mal wagt es die rechte Hand, ganz langsam im Takt, damit die linke mitkommt. Charlotte, unten an der Treppe, rührt sich nicht, in der entsetzlichen Stille, die nun eintritt.
‚Nein! Nein! Das ist nicht Mama!‘, denkt sie immer wie-der in der lastenden Stille. ‚Und wenn sie noch so krank wäre, so fürchterlich könnte Mama niemals spielen.‘
Kein Ton mehr. Eisige Stille entströmt dem Zimmer, dass der Atem des Kindes stockt. Aus der Tiefe des Flurs kommt die alte Dienerin. Sie wischt sich die Augen, hält den Finger an den Mund, führt das Kind bis an den Tümpel in den Gar-ten zurück, unablässig redend, leise.
Ja, ja, der Vater habe gespielt, obwohl er doch gar keine Übung habe. Sie wollte es noch einmal … sie wollte es hören, weil sie zu schwach sei, selbst zu spielen.
,,Du musst im Garten bleiben!“, sagt sie beinah barsch, damit Charlotte ihre Unruhe nicht bemerken soll, ,,du darfst nicht hereinkommen, das ist nichts für Kinder! Man wird dich schon rufen! Doktor Neri ist ja da!“
Charlotte setzt sich wieder auf die Bank; sie starrt angsterfüllt auf das stille Haus. Ein nie gekannter Schreck sitzt ihr im Herzen.
Nach zwei Stunden wird es lebendig. Die Magd kommt heraus. Weit hält sie den schweren Eimer von sich und schüttet ihn vorsichtig aus. Sie steht da und hält sich die Schürze vors Gesicht. Sie geht am Haus entlang auf die Scheune zu, deren Tor offensteht, ruft etwas hinein, mit unterdrückter Stimme. Gleich darauf erscheinen die beiden Knechte und Jean Chappe, der Kutscher, und sehen zur Magd hin, die ihnen zunickt und langsam zum Haus zurück geht. Hinter ihr setzen sich die drei in Bewegung. Unten an der Treppe ziehen sie ihre Stiefel aus, stellen sie umständlich nebeneinander auf die unterste Stufe, bevor sie steifbeinig, einander den Vortritt lassend, unter dem Portal ver¬schwinden. Das Fenster wird geschlossen. Nach fünf Minu¬ten kommen die Knechte wieder aus dem Haus, zögernd, mit verschlossenen Gesichtern, gehen hintereinander die Treppe hinab, steigen nacheinander in ihre Schaftstiefel und ziehen sich, einer hinter dem anderen, vorsichtig auftretend in die Scheune zurück, während das Fenster wieder geöffnet wird …
Eine namenlose Angst packt das Kind. Aber es rührt sich nicht vom Fleck.
Nun tritt ein beleibter Mann – es ist Doktor Neri – unter das Vordach. Er bleibt einen Augenblick unschlüssig stehen. Hinter ihm auf der Schwelle erscheint Charlottes Vater, ein hochgewachsener Mann in einem apfelgrünen Flauschrock. Er lehnt sich an den Türrahmen und blickt über den Doktor hinweg in den Garten. Die Katze unter dem offenen Fenster erhebt sich und streicht um Doktor Neris Beine. Er bückt sich, um sie zu streicheln, tut es aber nicht. Eine Weile stehen sich die beiden stumm gegenüber. Schließlich hebt er bedauernd die Schultern, wendet sich zur Treppe, geht halb seitwärts hinab und ohne sich umzublicken zum einge-spannten Pferdchen, tätschelt es, hebt gleichzeitig die andere Hand nach hinten zum Haus, klettert in die quietschende Kutsche und fährt davon.
Der Vater kommt die Treppe herunter, geht langsam durch den Krautgarten auf Charlotte zu. Wie im Traum, wenn etwas Grauenvolles herankommt und man am Boden festgewachsen ist, sitzt sie auf der Bank, während der Vater wortlos, unerbittlich näherkommt. Schwer geht sein Atem, sein Mund zuckt. Es sieht einen Moment so aus, als ob er lächeln wolle. Ein schriller Schrei stößt in die Stille:
„Vater!“
Er legt seine schwere Hand auf ihren Kopf und sagt mit viel zu lauter Stimme, die aber beruhigend wirken soll:
„Komm, Charlotte!“